

Europa war noch vor wenigen Jahrzehnten das Zugpferd der Weltwirtschaft. Im Jahr 1989 herrschte am „alten Kontinent” Aufbruchsstimmung. Der Eiserne Vorhang fiel und die Öffnung zwischen West und Ost löste eine wirtschaftliche Blütezeit aus. 1989 betrug der Anteil der heutigen EU-Staaten, damals noch inklusive Großbritannien, am globalen Bruttoinlandsprodukt, bereinigt um Kaufkraftunterschiede, 27,8 Prozent. Die USA brachten es auf 22,2 Prozent und China spielte mit einem Anteil von 4,1 Prozent noch kaum eine Rolle. Europa war die führende Wirtschaftsmacht der Welt. Drei Jahrzehnte später hat sich das Kräfteverhältnis massiv verändert: Der Anteil der EU an der globalen Wirtschaftsleistung (zu Kaufkraftparität) – mittlerweile ohne Großbritannien – betrug 2022 nur noch 14,9 Prozent und landete damit hinter den USA (15,5 Prozent) und China (18,4 Prozent) auf Platz drei der Wirtschaftsmächte.
Das starke Wachstum in den USA und China ist für die Wirtschaft in Europa zwar zunächst eine gute Nachricht. Die exportstarke Industrie profitiert von der starken Nachfrage aus den dynamischen Wirtschaftsräumen. Gleichzeitig gerät gerade die Industrie zunehmend unter Druck – durch die vergleichsweise hohen Energiepreise und Arbeitskosten, durch stark zunehmende Bürokratie und einen Mangel an Arbeitskräften. Und viele Menschen treibt die Frage um: Wie wirkt sich der weltwirtschaftliche Gewichtsverlust auf die weltpolitische Durchsetzungskraft der EU aus und welche Gefahren bergen die Abhängigkeiten von fernen Absatzmärkten?
„Fronius ist ein Familienunternehmen mit starken Wurzeln in Europa und Österreich. Wir fertigen derzeit ausschließlich in Europa und auch der europäische Markt für Solartechnologie ist für uns unverzichtbar. Die USA haben allerdings mit dem IRA (Inflation Reduction Act) ein attraktives und unbürokratisches Modell implementiert, um die USA zum Standort Nummer 1 für die Herstellung von Produkten im Bereich der erneuerbaren Industrie zu machen. Anders als in Europa, wo die erneuerbare Industrie absatzmäßig gefördert wird, die Wertschöpfung in Europa aber bei den Förderungen nicht berücksichtigt wird, setzen die USA massiv auf eine Industrialisierung“.
Dass jetzt immer lauter von einer Deindustrialisierung Europas gesprochen wird, mag also kaum überraschen. Deindustrialisierung ist ein schleichender Prozess der Verlagerung von Produktionen in Weltregionen, in denen kompetitiv produziert werden kann – die Produkte also am Weltmarkt so angeboten werden können, dass sie im Vergleich zu Konkurrenzprodukten möglichst viele Vorteile haben. Ist das an einem von mehreren internationalen Standorten eines größeren Industrieunternehmens eher gegeben als an einem anderen, wird dort mehr investiert. Investitionen, die dann anderenorts für Wertschöpfung, neue Arbeitsplätze und mitunter auch technologischen Fortschritt sorgen. Die Industrie – das umfasst die Herstellung von Waren, Bergbau sowie Energie- und Wasserversorgung – trägt in Europa mit rund einem Fünftel einen signifikanten Anteil an der gesamten Wertschöpfung. Sinnbildlich steht dafür der Spruch, dass „wir nicht davon leben können, uns gegenseitig die Haare zu schneiden“.
Der Dienstleistungssektor hat einen Anteil an der europäischen Wertschöpfung vor mehr als 70 Prozent – mit einem Aber: global betrachtet sind die großen Wachstumstreiber im Dienstleistungsbereich Internetplattformen und Software-Dienstleistungen. „Die großen Technologieunternehmen in diesem Bereich sind aber nicht in Europa entstanden – sie sitzen in den USA und haben in China Zwillinge”, sagt Klaus Günter Deutsch, Chefökonom des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Die Stärke der europäischen Wirtschaft sind innovative Industrieunternehmen, die Produkte und Komponenten auf den Markt bringen, die in ihren jeweiligen Nischen Spitzenreiter sind. Unternehmen, die es derzeit nicht leicht haben in Europa.
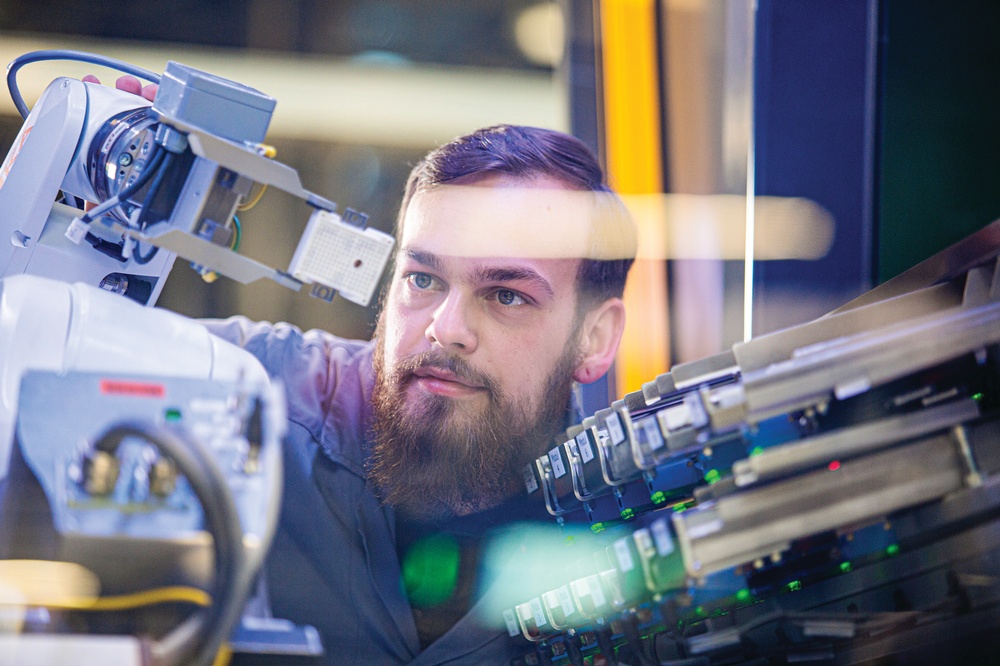
Die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen stehen, seien in erster Linie durch externe Faktoren bestimmt, meint der Ökonom. „Europa ist ganz generell durch Krieg, Inflation und geldpolitische Gegensteuerung, restriktive Geldpolitik, besonders stark betroffen”. Die größten Schwierigkeiten habe auch aus seiner Sicht die Abkopplung von russischen Energierohstoffen verursacht. „Wir mussten billige russische Ware durch etwas teurere Weltware ersetzen. Das hat dazu geführt, dass die Gaspreise noch immer deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen und wir nie wieder zu den niedrigeren Kosten für Erdgas zurückkehren können. Das bringt vor allem für die energieintensiven Branchen Schwierigkeiten“, sagt Deutsch. In diesem „Riesen-Berg an Kosten” sieht der Experte den unmittelbarsten Auslöser für die aktuellen Debatten rund um Wettbewerbsfähigkeit und Produktverlagerung.
Zu diesen kostenseitigen Schwierigkeiten kommt die derzeit ausgeprägt schwache Konjunkturentwicklung in China, die die Wirtschaftsaktivität in ganz Asien dämpft. „Das führt dazu, dass Impulse, die die Wirtschaft in Europa in den letzten 20 Jahren aus dem hohen Wachstum in Asien hatte, im Moment nicht zustande kommen”, sagt Deutsch. Das Problem ist aber gar nicht so sehr China als Abnehmer europäischer Produkte – der Anteil Chinas an den Exporten der EU liegt bei 10,3 Prozent – sondern vielmehr die chinesische Politik der Importsubstitution, die chinesischen Produzenten Vorteile im internationalen Wettbewerb gebracht hat. „Die Exportaussichten für die europäische Wirtschaft sind dadurch generell schlechter geworden. Am deutlichsten wird das bei E-Autos: Nach 20 Jahren der massiven Förderung im Bereich batterieelektrischer Fahrzeuge in China ist der Verkauf europäischer Modelle vor Ort schwächer geworden”, erklärt der Ökonom.
„Die Zinssteigerungen, mit denen die EZB gegen die Teuerung vorgeht, haben die Baubranche in ganz Europa stark ausgebremst. Investitionen in Neubau und Renovierungen gingen schlagartig zurück, öffentliche Aufträge etwa für Infrastruktur brachen weg, Baustellen wurden stillgelegt. Der Baumarkt ist überall rückläufig, aber das europäische Neubausegment wurde besonders stark getroffen. Das spüren auch wir, allerdings konnten wir trotzdem 2023 ein gutes Ergebnis erzielen. Konkret haben wir sehr rasch in das Kostenmanagement eingegriffen und zusätzlich technologische Innovationen umgesetzt, mit denen wir nicht nur Kosten, sondern auch Emissionen senken konnten. Insgesamt aber muss man festhalten, dass dieses Zinsniveau in Kombination mit der anhaltend hohen Inflation mittelfristig dem Wirtschaftsstandort Österreich schaden kann. Auch der Fachkräftemangel bremst Unternehmen aus. Hier braucht es Investitionen in Bildung und klug gesteuerte Migration."
Entgegen ihrem Ruf habe die EU-Kommission aber in den vergangenen Jahren wirtschaftspolitisch keinen schlechten Job gemacht. Deutsch: „Im Großen und Ganzen hat Europa auf die Folgen der Corona-Pandemie wirtschaftspolitisch stark, konsequent und erfolgreich reagiert”. Während gesundheitspolitisch einige Fragezeichen blieben, hätten Maßnahmen wie das Wiederaufbauprogramm NextGenerationEU mit einem Volumen von rund 800 Millionen Euro oder das SURE-Programm zur Sicherung von Arbeitsplätzen wirtschaftspolitisch unerwartet starke Signale gesetzt. Auch auf die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs hat die EU nach Ansicht des Ökonomen richtig reagiert. „Auf den Energiepreisschock folgte sehr schnell und konsequent ein Mix aus mitgliedsstaatlichen und gesamteuropäischen Maßnahmen. Darüber hinaus ist es gelungen, einen Energieversorgungsengpass infolge der Sanktionspakete gegen Russland zu verhindern”, resümiert Deutsch.
Mit der unmittelbaren Krisenreaktion der EU ist der Ökonom zufrieden. Wie sieht es mit Strategien für mehr Unabhängigkeit in kritischen Bereichen wie Rohstoffen, bestimmten Pharmazeutika und essenziellen Mikroelektronik-Bauteilen aus? Trotz Krisenmodus sei es auch hier gelungen, wesentliche Rahmenregelungen zu schaffen – dazu zählt Deutsch etwa den Critical Raw Materials Act, den Chips Act und den Net Zero Industry Act. „Diese Gesetzesvorhaben haben eigentlich auch eine breite Unterstützung der europäischen Industrie ausgelöst”, sagt Deutsch. Dann kommt allerdings ein großes Aber. In der auslaufenden Legislaturperiode hat die EU-Kommission Regulierungsvorhaben auf den Weg gebracht und zu einem großen Teil auch schon abgeschlossen, die erhebliche Belastungen mit sich bringen.

Zu den externen Faktoren, die europäische Unternehmen derzeit vor große Herausforderungen stellen, werden nun auch hausgemachte Probleme immer deutlicher sichtbar. „Es geht um eine Reihe von Verordnungen, deren Ziele unstrittig sind. Unternehmen in Europa setzen diese Dinge allerdings ohnehin schon weitgehend um. Der Gesetzgeber war aber anscheinend der Ansicht, dass das umfassend bürokratisch dokumentiert und berichtet werden muss”, sagt Deutsch. Beispiele dafür gibt es viele. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive wurde beispielsweise die Verpflichtung zu Nachhaltigkeitsberichten stark ausgeweitet. Die Taxonomieverordnung der EU hat das Ziel, Kapitalströme in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten zu lenken. „Die Taxonomie ist im Grunde gescheitert und das Ziel, dem Kapitalmarkt sinnvolle Informationen bereitzustellen, so nicht eingetroffen”, urteilt Deutsch. „Wir haben gleich mehrere unterschiedliche Klimareportings, die gesetzlich verpflichtend sind. Das ist inkongruent und ein irrer Aufwand”. Zwischen 2019 und 2023 hat der europäische Gesetzgeber Unternehmen insgesamt 850 neue Verpflichtungen auferlegt, was mehr als 5.000 Seiten an Rechtsvorschriften entspricht. Jener Drang, umfangreiche Regeln zu setzen, an die sich idealerweise die ganze Welt halten soll, hat bereits einen eigenen Namen: „Brussels Effect”.
3 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE HERAUSFORDERUNGEN DER EU
Die Belastungen für Unternehmen in Europa steigen – speziell auch in Österreich. Einerseits durch die hohen Abgaben, andererseits auch durch die überbordende Bürokratie und die Auflagen, die von der EU kommen. Beispiele dafür sind die EU-Taxonomie und das Lieferkettengesetz. Wir müssen als Unternehmen in Personalressourcen investieren, um die Dokumentationen, die mit diesen Auflagen verbunden sind, zu erfüllen. Diese Zusatzkosten haben Unternehmen aus anderen Regionen nicht. Im Gegenteil, in den USA oder Asien wird zB. die Solarindustrie sogar noch hinsichtlich ihrer Produktionskosten durch Subventionen unterstützt. Das führt dazu, dass wir als produzierende europäische Unternehmen eher Belastungen erfahren, während Unternehmen aus anderen Regionen Unterstützungen bekommen.
Den Höhepunkt dieser Bürokratieorgie bildet die Lieferkettenrichtlinie, die trotz breitem Widerstand in vielen EU-Ländern und obwohl sie mehrfach bereits als abgewendet gegolten hatte, nun doch noch die erforderliche Mehrheit von 15 Mitgliedsstaaten gefunden hat, die für 65 Prozent der EU-Bevölkerung stehen. Das Ziel dieser umstrittenen Richtlinie hat auch in der Wirtschaft breite Unterstützung: Es geht darum, dass Lieferanten Menschenrechte und gewisse Umweltstandards wahren. Unternehmen in Europa kontrollieren das bereits so gut sie können. Mit der neuen Richtlinie werden nicht nur sehr große, sondern auch mittelständische Unternehmen dazu gezwungen, die Verantwortung für die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Endprodukte zu übernehmen. Ein Beispiel: Ein Unternehmen bietet rund 1000 Produkte an, die bestehen aus rund 700.000 Komponenten unterschiedlichster Lieferanten, die wiederum rund 11 Millionen Materialien und Rohstoffe von Anbietern aus der ganzen Welt verarbeitet haben. Für dieses gesamte Netzwerk zahlreicher Lieferanten in vielen Ländern muss das Unternehmen schriftlich nachweisen, dass europäische Standards eingehalten wurden.

Die EU hat in den letzten fünf Jahren ein paar Großkrisen gemeistert und das eigentlich ganz gut hinbekommen. Sie hat aber parallel im Bereich der Umweltauflagen, der Berichtspflichten, der Dokumentationspflichten weit übers Ziel hinaus geschossen”, fasst Deutsch zusammen. Der EU ist das Problem durchaus bewusst – Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat mittlerweile das Ziel ausgerufen, die Bürokratie um 25 Prozent zurückfahren zu wollen. Die konkrete Einstellung von Richtlinien, die bereits in Kraft sind, stellt sich der Ökonom allerdings schwierig vor: „Das wird ein politischer Kraftakt in der nächsten Legislaturperiode”.
Was man im Krisenmodus leicht übersehen kann: Am Wirtschaftsstandort Europa läuft auch Vieles gut. Selbst die Regulierungswut hat mitunter positive Effekte. Im Februar kündigte der amerikanische Tech-Riese Microsoft an, 3,3 Milliarden Euro in den Standort in Deutschland investieren zu wollen. In einer Zeit, in der von Standortschwäche und Verschiebung von Investitionen gesprochen wird. „Das hat natürlich für einige Verwunderungen gesorgt. Damit hat jetzt eigentlich keiner so gerechnet”, sagt auch Deutsch und erklärt sich den milliardenschweren Schritt mit der Rechtssicherheit, die der AI Act der EU bietet. Mit dem Geld will Microsoft seine Projekte in Künstlicher Intelligenz in Europa ausbauen. Gerade im Hochtechnologiebereich gibt es in Europa derzeit durchaus bemerkenswerte Direktinvestitionen – etwa auch bei Halbleitern oder E-Mobilität. Investiert wird aber auch im großen Stil in erneuerbare Energie. „Das Problem ist nur, dass derzeit noch niemand abschätzen kann, wie viele neue Projekte auf der einen Seite entstehen und wie viel durch strukturelle Schwierigkeiten etwa bei den Energiepreisen verloren geht – was bleibt unter dem Strich übrig?”, meint Deutsch. Jedenfalls müsse der Wandel schneller möglich sein, sagt der Ökonom in Hinblick auf schleppende Planungs- und Genehmigungsverfahren in zahlreichen EU-Ländern. Ein Beispiel: Wird in Deutschland ein Windrad von einer Produktionsstätte an die Nordsee transportiert, ist dafür ein Schwerlastfahrzeug mit Überbreite notwendig. Dafür genügt nicht eine Genehmigung, es ist für jeden unterschiedlichen Straßenabschnitt eine eigene notwendig – fünf bis zehn Genehmigungen für eine Fahrt.
Das wichtigste Kapital Europas sind die Menschen. Die EU verfügt über eine Bevölkerung mit einem hohen Grad an Bildung und – trotz Inflation – weiterhin relativ hoher Kaufkraft. Darüber hinaus sind wir stark in Forschung und Innovation. Diese Stärken muss die EU bewahren und weiter ausbauen. Ein entscheidender Faktor ist natürlich auch der Binnenmarkt, in dem sich Güter und Menschen frei dorthin bewegen können, wo sie am meisten gebraucht werden. Das erfordert natürlich eine gewisse Einheitlichkeit bei Regularien und Produktkriterien, sichergestellt durch die Europäische Kommission. Doch dabei dürfen Unternehmen nicht übermäßig mit Bürokratie belastet werden. Gerade jetzt, in einem global herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, braucht es eine Pause der Überregulierung.
Doch zurück zu den Stärken. Neben dem großen Binnenmarkt, der vor allem für die Industrie sehr gut funktioniert, nennt Deutsch gleich an zweiter Stelle ein Stärkefeld, das auf den ersten Blick vielleicht überraschen mag: digitale Technologien. Wenn wir googeln, whatsappen oder snapchatten sind ebenso in den USA entwickelte Anwendungen im Einsatz, wie bei der mittlerweile fast selbstverständlich gewordenen Nutzung von ChatGPT, der bekanntesten Anwendung von künstlicher Intelligenz. Dieses Rennen meint der Ökonom aber gar nicht – das sieht auch er so gut wie verloren: „Wir werden sicherlich im Bereich der Technologie nicht mehr 20 Jahre Fehlentwicklung bei den Konsumentenplattformen korrigieren können, aber in den vielen Feldern der industriellen Anwendung von künstlicher Intelligenz, Quantentechnologien und anderen neuen digitalen Technologien haben wir sehr gute Chancen, sehr gute Forschungseinrichtungen und viele Unternehmen, die dort wettbewerbsfähig sind”, sagt Deutsch. Die großen Technologiekonzerne aus den USA wären zwar von der Finanzkraft ausgehend besser aufgestellt, es zeige sich aber, dass sie kein großes Interesse haben, ihre Geschäftsfelder zu stark auszuweiten und daher noch nicht so stark in unmittelbar industriellen Anwendungsfeldern aktiv sind, erklärt der Ökonom.
In Energieeffizienz und industrieller Anwendung digitaler Technologien sieht er Europa auch in Zukunft punkten. Den Wirtschaftsstandort Europa will er nicht schlecht reden, im Gegenteil: „Man muss aufpassen, dass man die Dinge nicht aus der Perspektive verliert. Die Europäische Union hat immer noch einen Leistungsbilanzüberschuss, trotz all dieser Schwierigkeiten. Es ist ja nicht so, dass wir aufgrund unserer fehlenden Exportwettbewerbsfähigkeit einen Boom von Importen auslösen würden und nur noch aus dem Rest der Welt Teslas und Computer kaufen. Sondern tatsächlich ist es so, dass die gesamte europäische Wirtschaft auf dem Weltmarkt in unterschiedlichen Segmenten nach wie vor sehr erfolgreich ist. Zuletzt hat sich diese temporäre Reduzierung der Überschüsse durch extrem teure Energieimporte wieder normalisiert. Wir bewegen uns wieder auf eine Welt zu, in der Europa eine Wirtschaftsregion mit sehr hohen Ersparnissen und Kapitalexport und einem Handelsbilanzüberschuss ist”.
3 GROSSE STANDORTSTÄRKEN DER EU
Ein positives Beispiel für eine zukunftsgerichtete europäische Initiative ist der European Green Deal, mit dem Ziel der Klimaneutralität 2050. Zu diesem Ziel bekennen wir uns als wienerberger. Nachhaltiges Wirtschaften ist entscheidend, um kommenden Generationen höchste Lebensqualität zu ermöglichen – und das ist nicht zuletzt ein klarer Standortvorteil. Wir brauchen aber zusätzlich einen neuen EU Industrial Deal, der den EU Green Deal unterstützt und ergänzt und dadurch den EU-Binnenmarkt stärkt.
Wir müssen es schaffen, bestehende Förderungen intelligenter zu gestalten. Wir unterstützen die ambitionierten PV-Ausbauziele, aber es muss gelingen die Absatzförderung auch an europäische Wertschöpfung zu koppeln und so eine integrierte Industrie- und Klimapolitik zu betreiben.
.jpg)