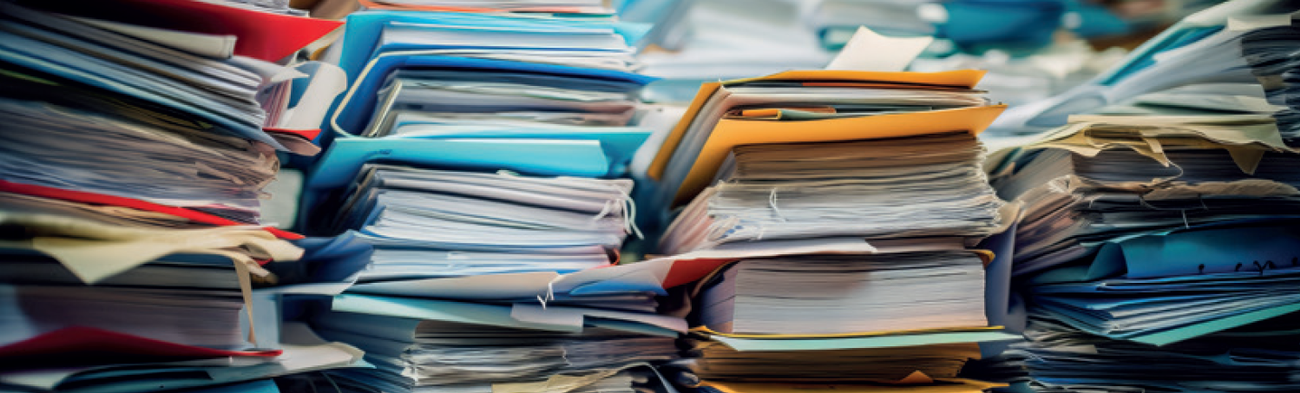
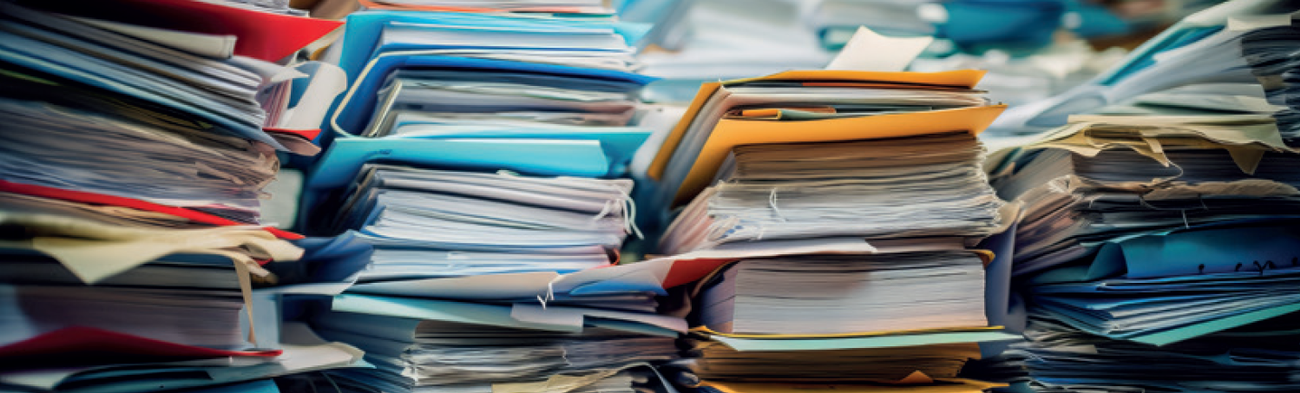
Man hört mittlerweile in jeder guten Standortdebatte, die Bürokratie müsse weniger werden, vor allem jene, die in EU-Gremien ausgetüftelt wird; Berichtspflichten, Lieferkettengesetz, Entwaldungsverordnung etc. – doch wie viel kosten diese umfassenden Regularien heimische Unternehmen tatsächlich? Das Wirtschaftsforschungsinstitut Economica hat sich in einer Studie im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV) den „Bürokratiestandort Österreich“ näher angesehen. Das Ergebnis: 10 bis 15 Milliarden Euro Bürokratiekosten verursachen EU- und nationale Gesetzgebung jährlich. Das entspricht 2,6 bis 3,8 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: Das heimische Budgetdefizit dürfte im Jahr 2025 knapp über 20 Milliarden Euro ausmachen. Im Durchschnitt müssen heimische Unternehmen 2,5 Prozent ihrer Umsatzerlöse für die Einhaltung bürokratischer Vorschriften aufwenden; Geld, das für nötige Investitionen an anderer Stelle fehlt.
Österreich ist Bürokratie-Mittelmaß
An welcher Stelle ordnet sich Österreich in diesem Themenfeld im europäischen Vergleich ein? Weder unter den EU-Musterschülern noch unter den Klassenletzten: Mit Platz elf nimmt man eine mittige Position ein. Während Unternehmen in Süd- und Osteuropa in der Regel höhere Bürokratiekosten verbuchen, sind jene in mit Österreich vergleichbaren Ländern Nordeuropas (Dänemark, Schweden, Finnland) deutlich geringer belastet. Der langfristige Trend zeigt in Österreich in Richtung mehr Bürokratie. Verantwortlich hierfür sind sowohl EU-Vorgaben als auch die nationale Gesetzgebung – Stichwort „Gold-Plating“ – und deren Vollzug durch heimische Behörden.
Bürokratie-Hochburg Brüssel?
Allein auf EU-Ebene hat sich das Volumen der Gesetzgebung seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon Ende 2008 nahezu verdoppelt. Knapp zehn Millionen Wörter umfasste die Summe aller EU-Verordnungen und -Richtlinien im Jahr 2024. Zwar führt nicht jeder Rechtsakt zwangsläufig zu mehr Bürokratie – gerade exportierende Unternehmen profitieren von EU-weit einheitlichen Regelungen –, doch in vielen Fällen (wie z. B. der bis 2026 umzusetzenden Lohntransparenz-Richtlinie) wird zusätzliche Regulierung geschaffen. Die vor Kurzem präsentierte EU-Omnibus-Initiative soll diesen Trend umkehren und unter anderem Bürokratieaufwand für Unternehmen reduzieren. Ziel der Kommission ist es, bis zum Ende ihres Mandats eine Verringerung des Verwaltungsaufwands um mindestens 25 Prozent und für KMU um mindestens 35 Prozent zu erreichen. Allein 6,3 Milliarden Euro Bürokratiekosten sollen die bisher veröffentlichten Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeits-Berichtspflichten, Lieferkettenrichtlinie, EU-Taxonomie und des CO₂-Grenzausgleichs freispielen.
Den Regulierungsdschungel lichten
Was lässt sich nun gegen das Dickicht heimischer Vorschriften und Regulatorik machen? Ein Mittel ist mehr Transparenz. Nach dem Vorbild des Bürokratieindex von Economica könnte Österreichs neue Regierung einen eigenen Bürokratiekostenindex (BKI) einführen. Im schwarz-rot-pinken Regierungsprogramm heißt es: „Die Bundesregierung bekennt sich zu einer Bürokratiebremse sowie zur transparenten Darstellung von Bürokratiekosten. Ein jährlicher Entbürokratisierungsbericht wird gelegt.“ Dieser Index böte eine erste quantitative Grundlage, um Fortschritte beim Bürokratieabbau zu messen und internationale Vergleiche anzustellen. Die Einrichtung eines eigenen Staatssekretariats für Entbürokratisierung schlägt in dieselbe Kerbe. Dieses kann als zentrale Anlaufstelle bestehende gesetzliche Verpflichtungen evaluieren, Empfehlungen zum Bürokratieabbau erarbeiten und in Zukunft bei neuen legistischen Vorhaben die Wettbewerbsfähigkeit sowie die nachhaltige Entwicklung des Standorts im Blick behalten. Weitere strukturelle Maßnahmen wären „One-in/One-out“-Regeln, Sunset-Klauseln, angemessene Evaluierungen und Wirkungsfolgenabschätzungen von Gesetzen sowie die Vermeidung des besagten „Gold-Plating“.
Täglich grüßt die Verwaltungsreform
Deutlich anspruchsvoller ist eine umfassende Verwaltungs- sowie Föderalismusreform. Wie schon der Österreich-Konvent Anfang der 2000er-Jahre darlegte, könnten hierdurch bestehende Doppelgleisigkeiten und ineffiziente Strukturen beseitigt und eine klare Aufgabenorientierung, Ausgabenverantwortung und mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung geschaffen werden. Im neuen Regierungsprogramm wird nun immerhin ein zweiter Verfassungskonvent geplant. Durch die Bündelung von Verwaltungsaufgaben, etwa in einer zentralen Serviceplattform (Personalverwaltung, Ressourcenmanagement, Controlling) ließe sich die öffentliche Verwaltung nicht nur günstiger, sondern auch effizienter betreiben. Der Ausbau von E-Government ist nicht nur aufgrund des aktuellen Arbeitskräftemangels ein Gebot der Stunde. Eine Stärkung des Once-only-Prinzips könnte sowohl Unternehmen und Bürger als auch Behörden von unnötigen Prozessen und Verwaltungsabläufen befreien. Letztlich sollte Bürokratieabbau nicht nur als Selbstzweck verstanden werden, um eine bürgernahe und effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat er darüber hinaus das Potenzial, Unternehmen zu entlasten und neue Zuversicht zu schaffen.