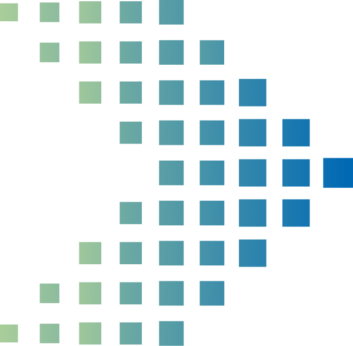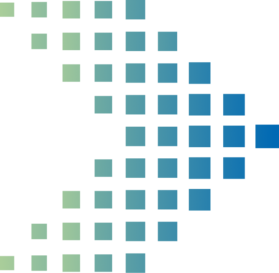Das Thema Sicherheit ist für Europa nicht nur angesichts des Ukraine-Kriegs in den Fokus gerückt – es ist auch zu einem wesentlichen Standortfaktor geworden. Die geplanten Investitionen in Sicherheit und Verteidigung bergen große Chancen, aber auch Herausforderungen für Industrie und Banken.
WIRTSCHAFTSFAKTOR SICHERHEIT

Eigentlich hatte der NATO-Gipfel 2024 das Zeug zu einem historischen Datum für das Verteidigungsbündnis: Der Gipfel fand in Washington statt, der Hauptstadt des mächtigsten Bündnispartners, und es war offensichtlich, dass die Kriege in und um Europa noch weit entfernt vom ersehnten Frieden waren. Mit Finnland und Schweden wuchs die NATO 2023 und 2024; und gleichzeitig feierte das Bündnis sein 75-jähriges Bestehen. Aus heutiger Perspektive mutet das Ergebnis des 24er-Gipfels wie ein Echo aus längst vergangenen Friedenszeiten an: So gratulierte man sich gegenseitig, dass nun endlich zwei Drittel der Mitglieder zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Verteidigung ausgeben. Dieses Ziel hatte sich die NATO zehn Jahre zuvor gesteckt.
Ein Jahr später war dann doch klar: Das wird nicht reichen. Der neue US-Präsident Trump erhöhte von Beginn an den Druck auf Europa. Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit wurden der EU als Standortfaktor so deutlich wie selten zuvor. Das Ergebnis war nun tatsächlich ein historischer Gipfel-Beschluss: Die 32 Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder einigten sich auf eine neue Zielmarke für Verteidigungsausgaben von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung. Davon sollen 3,5 Prozent direkt in die Rüstung fließen und 1,5 Prozent in Bereiche wie den Schutz kritischer Infrastruktur oder den Bau militärisch nutzbarer Straßen und Brücken. Zeit ist dafür bis 2035, und das wirtschaftliche Potenzial ist beträchtlich: Steigern EU-Staaten ihre Militärausgaben von zwei auf 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung, würde das laut einer Studie der London School of Economics (LSE) und des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel 0,9 bis 1,5 Prozent zusätzliches Wachstum bringen.
Russlands Rüstungsausgaben lagen 2024 laut dem Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) bei 7,1 Prozent des BIP – fast das Doppelte der USA, die 3,4 Prozent aufwendeten. Am nächsten dran am neuen NATO-Ziel von fünf Prozent des BIP war vergangenes Jahr Polen mit 4,2 Prozent; Deutschland lag mit 1,9 Prozent nahe am bisherigen Zwei-Prozent-Ziel. Finnland und Dänemark lagen mit 2,4 bzw. 2,3 Prozent darüber, Spanien, Portugal oder Italien mit 1,4 bis 1,6 Prozent darunter. Österreich – kein NATO-Mitglied – gab 2024 lediglich ein Prozent seines BIPs für Verteidigung aus. Für 2025 hat die Regierung bereits um 18 Prozent höhere Ausgaben budgetiert, und zwar 4,74 Milliarden Euro. Bis 2032 sollen die Ausgaben auf zwei Prozent des BIPs steigen – drei Jahre bevor für NATO-Länder das neue Ziel von fünf Prozent gilt.
Industrie am NATO-Gipfel
Beim Auf- und Ausbau der Verteidigungsfähigkeit Europas spielt die europäische Industrie eine gewichtige Rolle. Gerade in sicherheitskritischen Bereichen ist es naheliegend, nicht von Technologien aus dem Ausland abhängig zu sein. Dementsprechend groß war das Interesse am NATO-Gipfel heuer auch unter Unternehmen. Auch Markus Beyrer, Generaldirektor des europäischen Industrie-Interessenverbands BusinessEurope, war zum ersten Mal dabei. „Die Welt hat sich verändert und wir müssen uns darauf einstellen. Ein wichtiger Aspekt: Wir müssen wirtschaftlich stärker werden, wir müssen mehr wachsen, wir müssen mehr Spielraum schaffen“, sagte der Industrie-Experte im Rahmen einer Podiumsdiskussion am internationalen Kongress Salzburg Summit, der heuer bereits zum sechsten Mal von der Industriellenvereinigung (IV) veranstaltet wurde. Die Verteidigungsfähigkeit Europas als wichtiger Wirtschaftsfaktor war auch auf dem Summit in Salzburg Thema – nicht nur am Podium, sondern auch beim Austausch abseits des Vortragssaals, denn der Kongress bringt Industriebosse aus Österreich mit internationalen Geopolitik-Strategen, Ökonomen und Politikern aus Europa und darüber hinaus zusammen. „Sicherheit ist eine Grundlage dafür, dass eine Gesellschaft stabil ist, dass hier investiert werden kann, dass man Erwartungen hat, hier Geld verdienen zu können“, fasste EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer zusammen, die mit Beyrer sowie Valerie Brunner aus dem Vorstand der Raiffeisen Bank International und Verbund-CEO Michael Strugl auf der Bühne über „It’s the economy, stupid! Preparing Europe’s Defence Transition“ diskutierte.

Rund 150 Unternehmen aus Österreich sind im Bereich Sicherheit und Verteidigung tätig, schätzt die Wirtschaftskammer. Hinzu kommen zahlreiche Zulieferer von Komponenten, Software und Dienstleistungen. In Summe erwirtschaftet der Bereich in Österreich laut einer Studie des Economica-Instituts 2,8 Milliarden Euro pro Jahr oder 0,81 Prozent der österreichischen Bruttowertschöpfung. Beyrer sieht große Chancen – nicht nur für österreichische Unternehmen, sondern für die gesamte europäische Industrie – und auch eine Möglichkeit, Bereiche, die sich schon seit vielen Monaten oder Jahren schwach entwickeln, durch neue Betätigungsfelder auszugleichen: „Ich sehe das auch als Chance für die Reindustrialisierung Europas.“
Rüstungsriesen
Derzeit befindet sich unter den zehn größten Unternehmen im Bereich Rüstung und Militärdienstleistungen mit BAE Systems nur ein europäisches (und keines aus der EU; BAE hat seinen Sitz in London). Die ersten fünf Ränge belegen US-Unternehmen, gefolgt von BAE, dann kommen eine russische Firma und drei chinesische. Aber es gibt viele kleinere Industriebetriebe in Europa, die gemeinsam in dem Bereich Großes schaffen, wie RBI-Vorständin Valerie Brunner in Salzburg veranschaulichte: Der Radpanzer Pandur wird von General Dynamics zusammengeschraubt – es sind aber rund 200 österreichische Zulieferer, die dafür ihren Beitrag leisten. „Es ist eine wirklich breit gefächerte Industrie, die jetzt zu einem neuen Leben kommt“, so Brunner. Um global in der obersten Liga mitspielen zu können, müsse die Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern besser funktionieren, mahnte Beyrer ein: Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich gibt es etwa in der fünften Generation keinen Nachfolger für das europäische Kampfflugzeug Eurofighter – die Europäer mussten auf die amerikanische F-35 zurückgreifen. Und auch jetzt stehe die Entwicklung der sechsten Generation nicht unter einem guten Stern.
Grünes Licht für Investments
Die Verteidigungsindustrie in Europa und Österreich hochzufahren wird Milliardeninvestments benötigen. Europäische Banken sind seit einigen Jahren auf ESG-Kriterien ausgerichtet, und hinzu kommt, dass man im Sicherheitsbereich schnell vor Fragen steht, die schwer zu beantworten sind. „Bei Dual-Use-Gütern – also solchen, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können – müssen wir genau prüfen und abwägen: Wo landen diese Güter potenziell? Wir müssen sehr gut analysieren, wer die Abnehmer sind, in welchem Land sich diese befinden und ob dieses Land gerade in einem militärischen Konflikt ist“, erklärte Brunner. Dabei geht es um ein sehr breites Spektrum – von Software für Flugtracker bis hin zu Halbleitern, die möglicherweise in Waffensystemen verbaut werden könnten. Um hier leichter Entscheidungen treffen zu können, würde sich Brunner eine Art „grünen Pass“ für Verteidigungsinvestitionen wünschen: „Die Frage, ob bestimmte Güter im Bereich Rüstung und Verteidigung okay sind für eine Finanzierung, sollte nicht von Banken beantwortet werden müssen“, so die Bankerin.
Privates Kapital mobilisieren
Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) ist mit ihren Darlehen, Garantien und Eigenkapitalfinanzierungen auf dem Weg zur eigenständigen Verteidigungsfähigkeit Europas sehr gefragt. Allein heuer fließen 3,5 Milliarden Euro über die Bank der EU – binnen zwei Jahren hat die Investitionsbank ihr Engagement im Bereich Verteidigung auf 3,5 Prozent des EIB-Budgets verdoppelt. „Das umfasst Kredite und Finanzierungsinstrumente in den Bereichen Risikokapital oder Unterstützung für F&E, aber auch klassische Infrastrukturinvestitionen, etwa für Brücken, über die Panzer fahren können“, erklärte EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer auf der Salzburg-Summit-Bühne. Die Bandbreite ist groß und reicht von Hochindustrie bis hin zu kleinen Startups. Beer erzählte beispielhaft von einem Münchner Jungunternehmen, das Waldbrände mit Satelliten aufspürt, die – mit anderen Sensoren ausgestattet – aber auch im Verteidigungsbereich höchst nützlich sind. Auch die EIB setzt sich intensiv damit auseinander, was mit ihren Regeln zur Finanzierung vereinbar ist. „Wir machen den Ankerinvestor und vergeben damit eine Art TÜV-Siegel – das ist ein gutes Projekt – wodurch mehr als 50 Prozent privates Kapital mit in diese Projekte kommt“, so Beer. Für sie ist eine Stärkung der Kapitalmarktunion daher ein Schlüssel für die Finanzierung der Zukunft der europäischen Sicherheit: „Diese Herausforderungen können nicht ausschließlich mit Steuergeldern finanziert werden. Wir müssen die Rahmenbedingungen so stellen, dass privates Kapital – und wir haben in Europa 33 Billionen Euro auf Sparbüchern liegen – in solche Innovationsprojekte mit reinkommt. Es ist unsere Aufgabe, das zu hebeln.“ Für Europa wird es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein Kraftakt, die Rolle der Schutzmacht für sich selbst zu übernehmen.